Israel ist ein so kleines Land, dass man auf den meisten Landkarten und Globen
seinen Namen nicht einmal voll ausschreibt. Fast immer heißt es »Isr.« und schon
aus diesem Grund fällt es uns so schrecklich schwer, die im Sechstagekrieg
besetzten Gebiete aufzugeben. Sie würden endlich Platz für das bisher fehlende »-ael«
schaffen.
Israel wird als einziges Land der Welt von Steuerzahlern finanziert, die
außerhalb seiner Grenzen leben.
Es ist im wahrsten Sinn des Wortes ein grenzenloses Land.
Es ist ein Land, in dem die Mütter von ihren Kindern die Muttersprache lernen.
Die Einwohner dieses Landes schreiben hebräisch, lesen englisch und sprechen
jiddisch.
Es ist ein Land, in dem die Väter saure Trauben gegessen haben, damit die Kinder
gesunde Zähne bekommen.
Jeder Bewohner dieses Landes hat das gesetzlich verbriefte Recht, frei
auszusprechen, was er denkt. Aber es gibt kein Gesetz, das irgendeinen anderen
Bewohner verpflichten wurde, ihm zuzuhören.
Israel ist, nicht zuletzt dank der freundlichen Mithilfe der arabischen Welt,
das aufgeklärteste, fortschrittlichste und modernste Land der ganzen Gegend.
Wir haben in diesem Land sehr häufig Wahlen, aber nur selten eine Wahl.
Der Staat Israel ist ein organischer Bestandteil seiner Gewerkschaften.
Israel ist ein Land, das beträchtlich weniger produziert, als es zum Leben
braucht, und in dem trotzdem noch niemand Hungers gestorben ist.
Es ist ein Land, in dem niemand Wunder erwartet und jeder es als
selbstverständlich hinnimmt, dass sie geschehen.
Es ist ein Land, dessen Einwohner in ständiger Lebensgefahr schweben, was sie
aber weniger aufregt als das Radio, das in der Nachbarwohnung zu laut angedreht
ist.
Es ist ein Land, dessen Soldaten nicht grüßen und nicht Habacht stehen können.
Aber sie können kämpfen.
Es ist ein Land, in dem jeder Mensch ein Soldat und jeder Soldat ein Mensch ist.
Es ist das einzige Land, in dem ich leben kann. Es ist mein Land.
Unsere gelegentlichen Beschwerden werden von den United Nations immer streng objektiv behandelt. Die UN wahren das Prinzip »Gleiches Recht für beide«
(in Fachkreisen auch UN-Recht genannt).
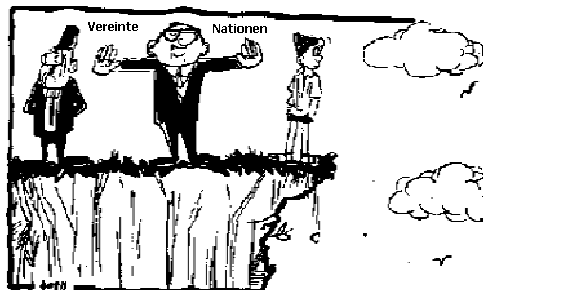
Jeder israelische Versuch, aus Wüstensand, Sumpf und Gestein ein fruchtbares Land zu machen, wird von den Arabern als Provokation betrachtet, auf die sie mit energischen Gegenmaßnahmen - Wirtschaftsboykott, Sperrung des Suezkanals, Ableitung der Jordanquellen und ähnlichem - antworten. Die unausbleibliche Folge: ein völliger wirtschaftlicher Zusammenbruch. Bei den Arabern.
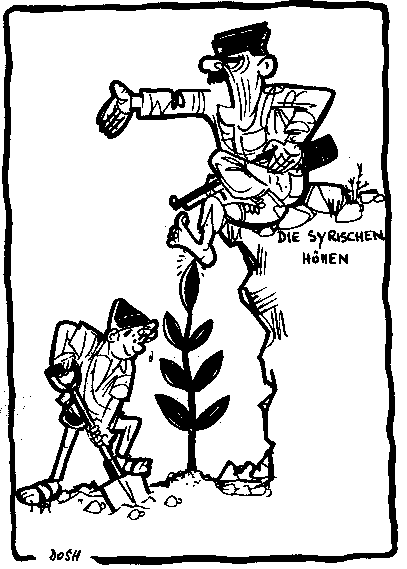
Was die Finessen der Weltpolitik betrifft, so haben wir die anderen Völker noch nicht ganz eingeholt. Hingegen ist es uns gelungen, den Mann einzuholen, der die Vernichtung unseres eigenen Volkes durchzuführen hatte, und ihn vor Gericht zu stellen. Der Fall hatte etwas Surrealistisches an sich. Man konnte im Gerichtssaal beinahe plastisch die Gedankengänge einer überwirklichen Ratte verfolgen.
Staatsanwalt: Wieviel ist Ihrer Ansicht nach zwei mal zwei?
Adolf: Herr Staatsanwalt, ich bin kein Mathematiker.
Staatsanwalt: Ich möchte trotzdem wissen, wieviel Ihrer Ansicht nach zwei mal zwei ist.
Ich habe mich mit solchen Dingen nie beschäftigt. Wenn ich es mit Problemen
dieser Art zu tun bekam, habe ich sie an die zuständige Abteilung
weitergeleitet. Die Entscheidungen wurden in jedem Fall von Schulze getroffen.
Staatsanwalt:
Sie wissen also nicht, wieviel zwei mal zwei ist?
Ich kann darüber keine Angaben machen, Herr Staatsanwalt.
Staatsanwalt: Und wenn ich Ihnen auf den Kopf zusage, dass Sie es wissen?
Ziffern waren die Sache von Schulze.
Staatsanwalt: Immer, wenn Sie wissen wollten, wieviel zwei mal zwei ist, haben Sie nach
Schulze geschickt?
Nicht immer. Manchmal konnten die betreffenden Fragen auch telephonisch geklärt
werden. Ich möchte bei dieser Gelegenheit bemerken, dass Schulze Ende, 1943 in
das Salzkammergut versetzt wurde und dass ich ihn erst dort zusammen mit Lehmann
getroffen habe.
Staatsanwalt:
Wusste auch Lehmann, wieviel zwei mal zwei ist?
Das weiß ich nicht. Danach habe ich ihn nie gefragt. Mein Vorgesetzter war, wie
schon erwähnt, Schulze.
Staatsanwalt: Wusste Schulze die richtige Antwort auf die Frage: »Wieviel ist zwei mal zwei?«
Das kann ich nicht sagen. Ich hatte keine Möglichkeit, in sein Inneres zu sehen.
Staatsanwalt:
Aber Sie durften sicher sein, dass er die Antwort wusste?
Ich habe mir niemals ein Urteil über meine Vorgesetzten angemaßt.
Staatsanwalt: Wieso wissen Sie dann, dass Schulze für diese Dinge zuständig war? Er kann doch
nur dann zuständig gewesen sein, wenn er wusste, wieviel zwei mal zwei ist?
Woher wissen Sie, dass er das nicht wusste? Oder dass er es wusste?
Ich wusste es nicht. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich sogar daran
gezweifelt. Ich bin kein Mathematiker.
Staatsanwalt: Dann erklären Sie mir, wieso das Dokument Nr.6013 in Ihrer Handschrift den
Vermerk »2 x 2 = 4« trägt.
Das ist unmöglich.
Staatsanwalt:
Hier. (Reicht ihm ein Dokument) Haben Sie das geschrieben?
(nach sorgfältiger Prüfung des Dokuments) Ja.
Staatsanwalt: Das ist also Ihre Handschrift?
Nein.
Staatsanwalt: Nein? Wieso nicht?
Zu dem auf diesem Dokument angegebenen Zeitpunkt war ich nicht in Berlin.
Staatsanwalt: Das Dokument wurde in München ausgefertigt.
Ich war auch nicht in München. Ich hatte damals gerade in Dachau zu tun.
Staatsanwalt: Was hatten Sie in Dachau zu tun?
Mir fällt soeben ein, dass ich in Linz war.
Staatsanwalt: Wie kommt dann Ihre Unterschrift auf dieses Dokument?
Sie wurde später hinzugefügt. Ich möchte darauf hinweisen, dass die auf diesem
Dokument angebrachten Ziffern nicht sehr gut leserlich sind. Besonders die
Ziffer 4 ist undeutlich und kann sehr leicht mit der Ziffer 7 verwechselt
werden.
Staatsanwalt: Zwei mal zwei wäre dann also sieben?
Das habe ich nicht gesagt. Ich bin kein Mathematiker. Meine Bemerkung bezog sich
ausschließlich auf die Form der Ziffer 4, die mich an die Form der Ziffer 7 im
Dokument Nr.6013 erinnert.
Staatsanwalt: Wollen Sie jetzt angeben, wo Sie sich zum fraglichen Zeitpunkt aufgehalten
haben?
In Dachau.
Staatsanwalt: Angeklagter, Sie sollen die Frage beantworten, wieviel zwei mal zwei ist.
Nicht sieben. Ich habe nie gesagt, dass es sieben ist. Ich habe nur gesagt, dass
mich die Ziffer 4 auf manchen Dokumenten an die Ziffer 7 erinnert.
Staatsanwalt: Wir sprechen jetzt nicht über »manche Dokumente«. Wir sprechen über das Dokument
Nr.6013.
Für dieses Dokument bin ich nicht verantwortlich, weil ich zur Zeit seiner
Ausfertigung in Linz war.
Staatsanwalt:
Also doch Linz und nicht Dachau?
Soweit ich das aus dem Gedächtnis rekonstruieren kann.
Staatsanwalt: Für mich besteht nicht der geringste Zweifel, dass Sie ganz genau wissen,
wieviel zwei mal zwei ist.
Ich muss wiederholen, dass ich kein Mathematiker bin.
Staatsanwalt: Heben Sie zwei Finger Ihrer rechten Hand.
(tut es) Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen...
Staatsanwalt: Ich habe Sie zu keiner Eidesleistung aufgefordert, sondern nur dazu, zwei Finger
zu heben.
Darf ich in diesem Zusammenhang noch eine Aussage machen?
Staatsanwalt: Ja.
Lehmann wurde 1943 ins Protektorat versetzt, so dass ihn Schulze in diesem Jahr
unmöglich im Salzkammergut treffen konnte.
Staatsanwalt: Ich verstehe den Zusammenhang nicht.
Wenn ich einen Eid ablege, Herr Staatsanwalt, dann lege ich einen Eid ab, um die
Wahrheit zu sagen. Lehmann hatte mit Schulzes Angelegenheiten nichts zu tun.
Staatsanwalt: Schön. Er hatte nichts mit ihnen zu tun. Aber darum handelt es sich nicht. Es
handelt sich darum, wie viele Finger Lehmann gehoben hat.
Soweit ich mich erinnern kann, hat Lehmann niemals irgendwelche Finger gehoben.
Staatsanwalt: Es war ja auch nicht Lehmann gemeint, sondern Sie. Wieviele Finger sind es, die
Sie jetzt gehoben haben?
Ich glaube: zwei. Vorsorglich und in jedem Fall möchte ich mich dagegen
verwahren, für etwaige Ungenauigkeiten auf diesem Gebiet verantwortlich gemacht
zu werden. Ich bin kein Mathematiker.
Staatsanwalt: Lassen wir das. Heben Sie jetzt noch zwei Finger Ihrer linken Hand.
(tut es).
Staatsanwalt: Wieviele Finger sehen Sie jetzt?
Zehn.
Staatsanwalt: Ich meine: erhobene Finger.
Aber ich kann auch die anderen sehen.
Staatsanwalt: Uns interessieren jetzt nur Ihre erhoben Finger.
Auch die nicht erhobenen Finger gehören mir. Sie stellen insgesamt 60 Prozent
meiner Fingeranzahl dar, also eine Majorität von 50 Prozent im Vergleich zu den
erhobenen Fingern.
Staatsanwalt: Ich möchte von Ihnen nichts anderes hören als die Gesamtanzahl der zwei mal zwei
Finger, die Sie gehoben haben.
Jetzt?
Staatsanwalt: Ja. Zählen Sie.
(versucht es erfolglos) Ich kann nicht.
Staatsanwalt: Warum nicht?
Ich bin gewohnt, so zu zählen, dass ich den Finger über die zu zählenden
Gegenstände gleiten lasse. Im hier vorliegenden Fall ist der Finger, mit dem ich
zählen soll, identisch mit einem der zu zählenden Finger, was mich sehr
verwirrt. Außerdem könnte es zu Ungenauigkeiten führen, und da ich unter Eid
stehe, muß ich auf größte Genauigkeit bedacht sein.
Darf ich noch eine Aussage machen?
Staatsanwalt: Ja.
Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, als ob ich die Leseart, derzufolge zwei
mal zwei unter bestimmten Voraussetzungen das Ergebnis vier oder ein annähernd
ähnliches Ergebnis haben kann, vollkommen von der Hand weisen wollte. Dessen
ungeachtet lege ich Wert auf die Feststellung, dass ich mich mit Arbeiten auf
diesem Gebiet niemals beschäftigt habe, weil das eine Überschreitung der mir
übertragenen, genau umschriebenen Zuständigkeit bedeutet hätte. Ich beantrage
daher die Einvernahme des Zeugen Schulze, der zum fraglichen Zeitpunkt Gauleiter
in Wuppertal war.
Staatsanwalt: Wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie mit Schulze de facto einer Meinung
darüber, dass zwei mal zwei vier ist.
Ich habe bereits wiederholt ausgesagt, dass ich über diesen Punkt nicht aussagen
kann, solange ich unter Eid stehe. Aber ich werde selbstverständlich alle aus
meiner Aussage entstehenden Folgen auf mich nehmen, um nicht den Eindruck zu
erwecken, dass ich mich meiner Verantwortung entziehen will.
Staatsanwalt: Schön. Wieviel ist zwei mal zwei?
Wenn ich nicht irre, habe ich darüber bereits ausgesagt.
Staatsanwalt: Ich möchte es noch einmal hören.
Ich habe darüber bereits ausgesagt, wenn ich nicht irre.
Staatsanwalt: Wiederholen Sie Ihre Aussage.
Bitte sehr. Ich kann nach bestem Wissen und Gewissen nur aussagen, dass das
Ergebnis der hier wiederholt gestellten mathematischen Aufgabe annähernd dem
entspricht, was Sie, Herr Staatsanwalt, vor einigen Minuten als Ergebnis
festgestellt haben.
Anmerkung: Diese Satire spielt sehr wahrscheinlich auf den Eichmann-Prozess 1961 in Jerusalem an. Adolf Eichmann war verantwortlich für die Judendeportationen in die Massenvernichtungslager. Unteranderem war Eichmann auch für Ungarn - Kishons Heimat - verantwortlich.
Staatsanwalt: Also vier.
Soweit ich das beurteilen kann.
Staatsanwalt: Vier!
Nach allgemeinem Dafürhalten.
Staatsanwalt: Zwei mal zwei ist vier - ja oder nein?
Das erstere.
Staatsanwalt: Danke. Das ist alles, was ich wissen wollte.
Es wird langsam Zeit, dass wir uns auf unsere außenpolitischen Möglichkeiten
besinnen. Die Knesset müsste sich in einer ausführlichen Sitzung mit der
irischen Frage befassen, und unser Außenminister müsste hernach den englischen
Botschafter zu sich berufen, um mit ihm eines jener »freundlichen und
konstruktiven Gespräche« zu führen, die im internationalen Verkehr üblich sind:
»Exzellenz«, hätte er zu sagen, »die israelische Regierung hat mich beauftragt,
der Regierung Ihrer Majestät unsere Haltung in der irischen Frage zur Kenntnis
zu bringen. Wie Sie zweifellos wissen, widmet die Knesset, unser Parlament,
dieser Frage die größte Aufmerksamkeit und hat sie erst vor kurzem in einer
sechsstündigen Sitzung aufs neue diskutiert. Ich habe die Ehre, Ihnen,
Exzellenz, unseren brennenden Wunsch nach einer baldigen Lösung des Konfliktes
auszudrücken, einer Lösung, die den legitimen Rechten des irischen Volkes
Rechnung trägt. Die israelische Regierung verurteilt jede Form von Terrorakten
und missbilligt den verantwortungslosen Gebrauch von Explosivstoffen, seien sie
auch noch so libyschen Ursprungs. Dessen ungeachtet wäre es unserer Meinung nach
ein schlechter Dienst an der Sache des Weltfriedens, wenn wir übersehen wollten,
dass die eigentlichen oder, wie wir sagen zu dürfen meinen, die fundamentalen
Ursachen des Problems in der 1921 erfolgten Annexion Nordirlands durch die
englische Krone zu suchen sind.«
An dieser Stelle wird unser Außenminister eine kurze Pause machen, wird sich
räuspern und zurechtsetzen und wird mit eindringlicher Stimme fortfahren:
»Die israelische Regierung weiß sich bei diesem Schritt im Einklang mit der
Mehrheit aller maßgeblichen internationalen Körperschaften. Sie ist aufs tiefste
besorgt über den circulus vitiosus, der aus den Gewalt- und Terrorakten auf der
einen und aus den übereilten Repressionsmaßnahmen auf der anderen Seite
entstanden ist. Wir sind deshalb nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss
gelangt, dass es nur eine einzige tragfähige Lösung geben kann, nämlich den
vollen und bedingungslosen Rückzug Englands von den 1921 willkürlich
festgelegten Grenzen. Erst wenn die Folgen der britischen Aggression restlos
getilgt sind und kein einziger Soldat Ihrer Majestät sich auf irischem Boden
befindet, wird in diese von Zwietracht und Blutvergießen heimgesuchte Region der
von uns allen so sehnlich erwünschte Friede einkehren. «
Noch eine kurze Pause. Und dann:
»Die konsequente Friedenspolitik meiner Regierung berechtigt und nötigt mich,
Ihnen, Exzellenz, klarzumachen, dass die Regierung des Vereinigten Königreichs
durch ihre hartnäckige Weigerung, sich aus allen - ich wiederhole: allen -
besetzten Gebieten zurückzuziehen, die alleinige Verantwortung für diese
unglückselige Situation auf sich geladen hat. Nicht Grenzen oder Grenzgebiete
gewährleisten die Sicherheit und den Wohlstand einer Nation, sondern
freundschaftliche Beziehungen zu ihren Nachbarstaaten, unerschütterliches
Vertrauen zu den Grundsätzen des Völkerrechts und ein ehrliches Bedürfnis nach
einem echten, dauerhaften et cetera Frieden.«
Unser Außenminister erhebt sich und tritt auf den englischen Botschafter zu:
» Ich bitte Sie, Exzellenz, meine Vorhaltungen unverzüglich an Ihre Regierung
weiterzuleiten, und verabschiede mich, auch im Namen von Ephraim Kishon und
seinem Freund Jossele, mit vorzüglicher Hochachtung ... «
Ende des Gesprächs. Ende des Wunschtraums.
Haben Sie jemals eine Schnecke ohne Haus gesehen oder einen gläsernen Hammer? Haben Sie jemals gehört, dass die kleinen Kinder den Storch bringen? Haben Sie jemals gelesen, dass ein Minister zu Fuß gegangen ist? Dann lesen Sie es hier.
Die Limousine des Ministers blieb unterwegs plötzlich stehen. Gabi, der
Fahrer, stellte den Motor ab und wandte sich um:
»Tut mir leid, Chef - aber Sie haben ja den Rundfunk gehört.«
Das bezog sich auf die Neun-Uhr-Nachrichten, die den Streik der
Kraftfahrergewerkschaft angekündigt hatten. Die Kraftfahrergewerkschaft wollte
sich mit der Gewerkschaft der Chemie-Ingenieure fusionieren, oder wollte die
Fusion mit der Transportarbeitergewerkschaft rückgängig machen, oder vielleicht
wollte sie etwas anderes. Jedenfalls streikte sie.
Gabi verließ den Wagen und begab sich ins Gewerkschaftshaus, um Instruktionen
einzuholen.
Der Minister saß mitten auf der Straße. Er konnte nicht Auto fahren.
Erfindungen, die auf einen Knopfdruck hin laute Geräusche erzeugen, flößten ihm
seit jeher Angst ein. Soweit seine Erinnerung zurückreichte, hatte er nur ein
einziges Mal ein Auto gesteuert. Das war vor vierzig Jahren, in einem
Vergnügungspark, wo der Minister - damals noch jung und ehrgeizig - sich einem
Autodrom anvertraut hatte. Später war er dann der führenden Partei beigetreten,
hatte Karriere gemacht und jederzeit einen Fahrer zur Verfügung gehabt.
Jetzt werde ich wohl einen Helikopter bestellen müssen, dachte der Minister. Man
erwartete ihn zu einer dringlichen Kabinettsitzung. Auf dem Programm stand die
Krise der Zementindustrie. Um elf Uhr.
Der Minister begann, die Passanten zu beobachten, die an seinem Wagen
vorbeihasteten. Ein merkwürdiges, fast abenteuerliches Gefühl überkam ihn: er
war auf der Straße. Mit Verblüffung stellte er fest, wie viele fremde Menschen
es im Lande gab. Er kannte nur die immer gleichen Gesichter, die er täglich in
seinem Ministerium sah. Fremde bekam er höchstens in anonymen Massen zu Gesicht,
am Unabhängigkeitstag oder im Fußballstadion bei... wie hieß doch das Ding...
beim Kupferfinale.
Der Minister stieg aus und ging die Straße entlang. Allmählich wuchs sein
Vertrauen in diese Art der Fortbewegung. Er dachte nach, wann er zuletzt etwas
dergleichen getan hatte. Richtig: 1951. Damals hatte ein Fernlaster seinen Wagen
gerammt und er war zu Fuß nach Hause gegangen, quer durch die Stadt, zu Fuß.
Die Blicke des Ministers richteten sich abwärts, dorthin, wo unterhalb der
Bauchwölbung seine Füße sichtbar wurden, seine eigenen Füße, die sich rhythmisch
bewegten, tapp-tapp, tapp-tapp, linker Fuß, rechter Fuß -jawohl, er wusste seine
Füße noch zu gebrauchen. Er wusste noch, wie man auf der Straße geht. Ein gutes
Gefühl. Nur die Schuhe sahen ein wenig fremdartig aus. Wo kamen sie her? Er hat
sich doch noch niemals Schuhe gekauft, oder?
Genaueres Nachdenken ergibt, dass er selbst überhaupt keine Einkäufe tätigt. Was
ist's mit diesen Schuhen? Er bleibt vor dem Schaufenster eines Schuhgeschäfts
stehen und starrt hinein. Seltsam. Ein völlig neuartiges Phänomen. Schuhe, viele
Schuhe, Herren-, Damen- und Kinderschuhe, paarweise arrangiert, auf Sockeln, auf
langsam rotierenden Drehscheiben, oder nur so.
In plötzlichem Entschluss betritt der Minister den Laden, einen hohen,
langgestreckten Raum mit Reihen bequemer Fauteuils und mit Regalen an den
Wänden, und in den Regalen Schuhe, nichts als Schuhe.
Der Minister schüttelt die Hand eines ihm entgegenkommenden Mannes:
»Zufrieden mit dem Exportgeschäft?«
»Mich dürfen Sie nicht fragen«, lautet die Antwort. »Ich suche
Sämischlederschuhe mit Gummisohlen.«
Der Minister sieht sich um. Wie geht's hier eigentlich zu? Nehmen die Leute
einfach Schuhe an sich oder warten sie, bis der Kellner kommt?
Eine Gestalt in weißem Kittel, vielleicht ein Arzt, tritt an den Minister heran
und fragt ihn, was man für ihn tun könne.
»Schicken Sie mir ein paar Muster«, sagt der Minister leutselig und verlässt den
Laden.
Draußen auf der Straße fällt ihm ein, dass er sich nicht zu erkennen gegeben
hat. Und dass er nicht von selbst erkannt wurde. Ich muss öfter im Fernsehen
auftreten, denkt der Minister.
Es wird spät. Vielleicht sollte er in seinem Büro anrufen, damit man ihm
irgendein Transportmittel schickt oder ihn abholt. Anrufen. Aber wie ruft man
an? Und wenn ja: wo? Er sieht weit und breit kein Telefon. Und sähe er eines,
wüsste er's nicht zu handhaben. Das macht ja immer seine Sekretärin, die gerade
heute nach Haifa gefahren ist, in irgendeiner Familienangelegenheit.
Außerdem wäre sie ja sonst in seinem Büro und nicht hier, wo es kein Telefon
gibt. Da - ein Glasverschlag - ein schwarzer Kasten darin - kein Zweifel: ein
Telefon.
Der Minister öffnet die Zellentür und hebt den Hörer ab: »Eine Leitung, bitte.«
Nichts geschieht. Der Apparat scheint gestört zu sein. Von draußen macht ihm ein
kleiner Junge anschauliche Zeichen, dass man zuerst etwas in den Kasten werfen
muss.
Natürlich, jetzt erinnert er sich. Er ist ja Vorsitzender des
Parlamentsausschusses für das Münz- und Markenwesen. Er kennt sich aus. Der
Minister betritt den nächsten Laden und bittet um eine Telefonmarke. »Das hier
ist eine Wäscherei«, wird ihm mitgeteilt. »Telefonmarken bekommen Sie auf dem
Postamt.« Eine verwirrende Welt fürwahr. Der Minister hält nach einem Postamt
Ausschau und erspäht auf der jenseitigen Straßenseite einen roten Kasten an
einer Häusermauer. Er weiß sofort, was das ist. In solche Kästen tun die
Menschen Briefe hinein, die sie vorher zu Hause geschrieben haben.
»Entschuldigen Sie«, wendet er sich an eine Dame, die neben ihm an der
Straßenkreuzung wartet, »bei welcher Farbe darf man hinübergehen?«
Er ist ziemlich sicher, dass sein Wagen immer bei grünem Licht losfährt. Aber
gilt das auch für Fußgänger? Der Menschenstrom, der sich jetzt in Bewegung
setzt, schwemmt ihn auf die gegenüberliegende Straßenseite mit. Dort, gleich
neben dem roten Kasten, entdeckt er ein Postamt, tritt ein, und wendet sich an
den nächsten
Schalterbeamten: »Bitte schicken Sie ein Telegramm an mein Ministerium, dass man
mich sofort hier abholen soll.«
»Mit einem Flugzeug oder mit einem Unterseeboot?« fragt der Schalterbeamte und
lässt zur Sicherheit die Milchglasscheibe herunter.
Der Mann scheint verrückt zu sein, denkt der Minister und geht achselzuckend ab.
Nahe dem Postamt befindet sich ein Zeitungsstand. Wie sich zeigt, hat der
Minister große Schwierigkeiten, unmarkierte Zeitungen zu entziffern. In den
Zeitungen auf seinem Schreibtisch sind die Artikel, die er lesen soll, immer
eingerahmt.
»Ein Glas Orangensaft?« fragt eine Stimme aus dem Erfrischungskiosk, vor dem er
stehengeblieben ist.
Der Minister nickt. Er ist durstig geworden und leert das Glas bis auf den
letzten Tropfen. Welch wunderbares Erlebnis: allein auf der Straße ein Glas
Orangensaft zu trinken und erfrischt weiterzugehen.
Der Kioskinhaber kommt ihm nachgerannt:
»45 Agorot, wenn ich bitten darf!«
Der Minister starrt ihn an. Es dauert sekundenlang, ehe er begreift, was gemeint
ist. Dann greift er in seine Tasche. Sie ist leer. Natürlich. Solche Sachen
werden ja immer von seiner Sekretärin erledigt. Warum musste sie gerade heute
nach Haifa fahren?
»Schicken Sie mir die Rechnung, bitte«, sagt er dem gierigen Inkassanten und
entflieht.
Als er endlich innehält, steht er vor einem in Bau befindlichen Haus. Die
emsigen Menschen, die rundum beschäftigt sind, beeindrucken ihn tief. Nur der
Lärm stört ihn ein wenig. Und was ist das für eine graue Masse, die sie dort in
dem Bottich zusammenmischen?
»Einen schönen guten Tag wünsche ich!«
Ein alter Mann, wahrscheinlich ein Sammler für irgendwelche neu aufgelegten
Anleihen, hält ihm die Hand hin. Auch ihn verweist er an sein Büro.
Immer neue Überraschungen: dort, in einer Reihe von Glaskästen, hängen Bilder
halbnackter Mädchen! Der Minister blickt auf - jawohl, er hat's erraten: ein
Kino. So sieht das also aus. Er empfindet heftige Lust, hineinzugehen und
endlich einmal einen Film zu sehen. Sonst kommt er ja nie dazu.
Der Minister klopft an die versperrte Eisentüre. Er muss mehrmals klopfen, ehe
eine verhutzelte Frauensperson den Kopf heraussteckt:
»Was los?«
»Ich möchte einen Film sehen.«
»Jetzt? Die erste Vorstellung beginnt um vier Uhr nachmittag.«
»Nachmittag habe ich zu tun.«
»Dann sprechen Sie mit Herrn Weiss.« Und die Eisentüre fällt ins Schloss.
An der nächsten Straßenecke steht ein ungewöhnlich großer, länglicher,
blaulackierter Wagen, der eine Menge wartender Leute in sich aufnimmt. Ein Bus!
schießt es dem Minister durch den Kopf. Erst vorige Woche haben wir ihnen das
Budget erhöht. Um 11,5 Prozent. Da kann ich ja einsteigen.
»Hajarkonstraße«, sagt er dem Fahrer. »Nummer 71.«
»Welcher Stock?«
»Wie bitte?«
»Machen Sie, dass Sie vom Trittbrett herunterkommen!«
Der Fahrer betätigt die automatische Tür und saust los.
Eine merkwürdige Welt mit merkwürdigen Spielregeln. Der Minister versucht sich
zu orientieren, kann jedoch mangels irgendwelcher Wahrzeichen - Hilton-Hotel
oder griechisches Restaurant - nicht feststellen, wo er sich befindet.
Menschen fluten an ihm vorbei, als wäre nichts geschehen. Dies also ist die
Nation, das Volk, die Masse der Wähler. Den jüngsten Meinungsumfragen zufolge
wird im Oktober jeder dritte dieser fremden Menschen für ihn stimmen. Der
Minister liebt sie alle. Er ist seit seiner frühesten Jugend ein überzeugter
Sozialist.
Endlich, auf vielfach verschlungenen Wegen, hat er zu seiner Limousine
zurückgefunden; gerade rechtzeitig, um den Fahrer Gabi herankommen zu sehen.
»Zwei Sonderzahlungen jährlich und erhöhtes Urlaubsgeld«, sagt Gabi.
Der Streik ist beendet. Sie steigen ein. Gabi lässt den Motor anspringen.
Und der Minister kehrt von seinen Abenteuern auf einem fremden Planeten in die
Welt seines Alltags zurück.
Da wir uns schon einmal in mitteleuropäische Gefilde gewagt haben, begeben wir uns ein bisschen nach Norden, genaugenommen in die bayerische Metropole, um dort dem umstrittensten Politiker der deutschen Gegenwart einen kleinen Besuch abzustatten. Es handelt sich zweifellos um eine gewichtige Persönlichkeit in mehrfacher Hinsicht.
Vor ungefähr zwei Jahren, kurz vor den Wahlen, erhielt ich eine überraschende
Einladung. Franz Josef Strauß, damals Kanzlerkandidat, verlieh seinem Wunsch
Ausdruck, mich zu einem privaten Abendessen zu treffen. Ich fragte Herrn Strauß,
ob ich darüber schreiben dürfte. Es wurde von ihm genehmigt, natürlich. Ich
wusste alles über Franz Josef Strauß, was ein gut informierter Mensch wissen
sollte, nämlich, dass er dick und ein Schattenkanzler mit sonnigen Aussichten
ist. Ich rief unser Auswärtiges Amt in Tel Aviv an, um mir Instruktionen geben
zu lassen. Dort sagte man mir, der Strauß-Experte sei zufällig gerade außer
Haus, möglicherweise in Singapur. Dann fiel mir der vernichtende Artikel einer
besonders progressiven Wochenschrift ein, die den bayerischen
Ministerpräsidenten als ein haargenaues Ebenbild des Satans darstellte. Das
entschied die Sache zugunsten von Strauß.
Wir trafen unsere Verabredung, und ich verbrachte die darauffolgenden Tage
damit, Erkundigungen bei informierten Kreisen in Deutschland einzuholen. Sie
ergaben ein ziemlich einheitliches Bild. Von zehn Befragten waren im Schnitt
neun gegen Strauß, und der Rest enthielt sich der Stimme. Der schwerwiegendste
Grund gegen ihn war sein Gewicht. Mindestens 100 Kilo, wenn nicht mehr, sagten
sie. Ein erfahrener Journalist ließ mich streng vertraulich wissen, dass Strauß
auch praktisch Analphabet sei. Ich antwortete milde, dass er, soviel ich wüsste,
den akademischen Abschluss in Geschichte und Altphilologie habe. Worauf er
sagte, das möge sein, aber ich könne nicht leugnen, dass der Mann dick sei.
Wir trafen uns also in München zum Essen. Als Herr Strauß ein bisschen verspätet
erschien, war ich erstaunt festzustellen, dass er dick ist. Oder besser, weniger
dick als rund. Ein runder menschlicher Dynamo, so energiegeladen, dass es
unmöglich ist, in seiner Gegenwart über die Energiekrise zu sprechen. Er kam von
selbst auf dieses Thema: »Ich bin der Meinung«, sagte Herr Strauß, »dass für die
gegenwärtige Ölkrise drei Pseudo-Finanzfaktoren verantwortlich sind, nämlich:
● das substanzlose wirtschaftliche Vakuum, das durch
unwirksame diplomatische Maßnahmen entstanden ist;
● die zunehmende Auswirkung der Inflationskurve auf
entwicklungshilfegierige Industrieländer;
● die Unfähigkeit subventionierter
Wirtschaftszweige, globalpragmatische Denkungsweisen anzuwenden.«
Ich sagte Herrn Strauß, dass ich in jeder Hinsicht mit Ihm übereinstimme. Mein
Gastgeber sei schließlich beides gewesen, Finanzminister und Energieminister,
ich jedoch noch nicht. Es ist also gar nicht erstaunlich, dass seine Meinung
besser fundiert sei als meine. Seine Antworten kamen prompt, als ob er sich auf
diesen Tag vorbereitet hätte.
Wir begannen unser Menü mit Schildkrötensuppe. Draußen standen bewaffnete
Wachen, die ab und zu nach uns schauten. Herr Strauß ist eine bevorzugte
Zielscheibe für europäische Freiheitskämpfer und eine großflächige noch dazu.
Während wir unsere Suppe aßen, wurde ich immer neugieriger auf den Menschen
hinter dem Politiker, auf sein Privatleben, seine Träume, seine Sehnsüchte.
»Ich glaube, Sie im Fernsehen auf einem Motorrad gesehen zu haben, Herr Strauß«,
sagte ich deswegen.
»Ich bin auch ein begeisterter Motorradfahrer.«
Es war offensichtlich, mit welcher Freude Herr Strauß auf die persönliche Ebene
umzuschalten bereit war. »Motorradfahren«, antwortete er, »hat fünf funktionelle
Grundvorteile:
● den unmittelbaren Kontakt zur sauerstoffreichen
Umgebung;
● das sportliche Hochgefühl, das durch die Kontrolle
über ein hochentwickeltes Instrument von ungeheuer dynamischer Potenz entsteht;
● die innere Befriedigung, seine eigenen
psychosomatischen Ängste durch die Bewältigung des Fahrrisikos zu überwinden;
● die Aspekte des durcheilten Panoramas individuell
zu entblößen;
● die relative Wirtschaftlichkeit des
Brennstoffverbrauchs dieses zweirädrigen Fahrzeugs.«
Ich stimmte ohne jeden Vorbehalt zu. Ich erkannte ganz einfach, dass Herr Strauß
ein absoluter Experte auf dem
politisch-sozial-militärisch-finanziell-motorradsportlichen Gebiet ist, der
seine Gedanken präzise zu layouten weiß. Deshalb beginnt jedes seiner Argumente
mit einem fetten Punkt und einer neuen Zeile.
Ermutigt machte ich einen zweiten Versuch, den Menschen hinter den fetten
Punkten zu entdecken, und fragte ihn nach seinem Familienleben. Wie sich
herausstellte, hat Herr Strauß die Absicht, mit seiner Familie zu einem
zweitägigen Urlaub nach Peking zu fahren. Er kennt wirklich jede bekannte und
unbekannte Größe aus dem Who is Who?, von Fidel Castro bis Shimon Peres.
Wohlwollend fragte mich Herr Strauß dann nach meiner Familie. Ich erzählte ihm
stolz, dass ich drei Kinder habe:
● Rafi;
● Amir;
● Renana.
Daraufhin kamen wir auf die Bevölkerungsexplosion in der dritten Welt zu
sprechen, ein umfangreiches Thema, das nach sechs fetten Punkten seitens Herrn
Strauß verlangte. Die Bereitschaft meines Gastgebers, jedes Thema bis zum
letzten fetten Punkt auszuschöpfen, beeindruckte mich. Er ist wirklich ein
Bulldozer, dachte ich im stillen, aber ein herziger.
Als wir beim Dessert angelangt waren, hatte ich mich sogar dafür entschieden,
dass er eigentlich nicht dick ist, eher horizontal. Ich meine, seine Höhe geht
in die Breite, das ist alles.
Dennoch, nach einem raschen Streifzug durch den Mittleren Osten mit zwei
palästinensischen Semikolons und einem Schrägstrich für Reparationszahlungen an
Israel, überkam mich der unwiderstehliche Drang, Herrn Strauß eine Frage zu
stellen, auf die er nicht mit einer seiner eloquenten Antworten parieren konnte.
Ich überlegte angestrengt und kam auf Schildkrötensuppe.
»Die Suppe war köstlich«, sagte ich, »obwohl es, soviel ich weiß, Probleme mit
Schildkröten gibt, weil sie sich im Winter nicht fortpflanzen.«
»Schildkrötenfortpflanzung im Winter«, sagte Herr Strauß, »bedarf vier
geopolitischer Grundvoraussetzungen:
● eines Gebietes mit genießbarer Vegetation, das mit
ausreichender Geländeabwechslung zwecks Ehestand und Nistmöglichkeiten
ausgestattet ist;
● des biologischen Fortpflanzungs- und
Arterhaltungstriebes, der auf bestimmte Jahreszeiten beschränkt ist;
● eines Klimas mit Temperaturen, die nicht unter 25
Grad Celsius im Schatten absinken.«
»Ohne Zweifel«, stimmte ich zu, »aber sagten Sie nicht, Herr Strauß, zur
Schildkrötenfortpflanzung im Winter seien vier Dinge nötig? Was ist denn nun das
vierte?«
»Schildkröten«, sagte Herr Strauß. Ich gab es auf, ich war ihm eben doch nicht
gewachsen. Wenn man seine erstaunliche Energie je für friedliche Zwecke nutzen
sollte, könnte man eine ganze Straße damit beleuchten.
Bevor wir uns trennten, machte ich einen letzten Versuch, ihm eine Antwort ohne
fette Punkte auf eine sehr persönliche Frage zu entlocken.
»Herr Strauß«, sagte ich, »was werden Sie tun, wenn Sie nicht zum Kanzler
gewählt werden?«
Zum erstenmal während unseres Gesprächs verschlug es meinem erlauchten Gastgeber
die Sprache. Sein fassungsloser Gesichtsausdruck ließ erkennen, dass er offenbar
den Sinn meiner Frage gar nicht recht verstanden hatte. Schließlich murmelte er
etwas wie, in diesem ganz unvorstellbaren, hirngespinstigen, fast grotesken Fall
würde er wahrscheinlich öfter auf die Jagd gehen.
Mit einem Gefühl des Triumphs stellte ich fest, dass er auf den fetten Punkt
verzichtete und nicht zu einer neuen Zeile ansetzte. Ich beschloss also, es
dabei zu belassen, keine weiteren Fragen.
Es war Zeit, zu gehen. Herr Strauß wirkte etwas bedrückt, trug seine Niederlage
aber wie ein Mann. Er schüttelte mir die Hand und wünschte mir und meiner
Familie alles Gute. Vorsichtig löste ich die Finger meiner rechten Hand wieder
voneinander und wandte mich zum Gehen. Nach einigen Schritten drehte ich mich
noch einmal nach dem Politiker Strauß um und wollte auch dem Menschen Strauß auf
Wiedersehen sagen, aber ich gewahrte nichts als einen runden Kanzlerkandidaten
inmitten eines Haufens fetter Punkte.